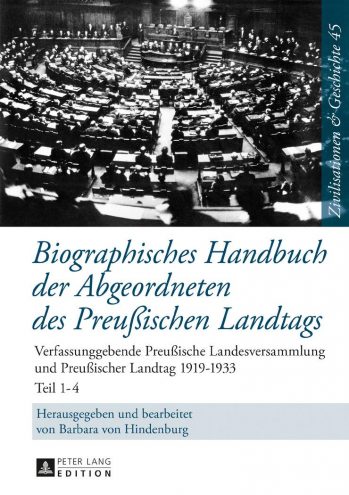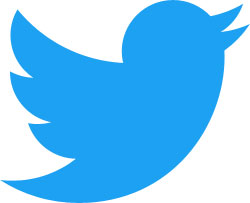Wie können Arbeits- und Privatleben in Einklang gebracht werden? Welche Folgen hat es, wenn das Verhältnis zwischen beiden nicht ausgeglichen ist? Das Problem gab es schon lange, bevor die „Work-Life-Balance“ Forschungsthema verschiedener Disziplinen wurde. Dr. Eva Ochs vom Institut für Geschichte und Biographie der FernUniversität in Hagen befasste sich in ihrem Habilitationsprojekt „Beruf als Berufung? Die Work-Life-Balance bürgerlicher Männer im 19. Jahrhundert“ mit historischen Entwicklungen, die zu Spannungen zwischen Beruf und Privatleben führten. Und wie gingen Männer damit um, dass ein neues Berufsethos und ein geändertes Familienideal an ihnen zerrten?
Wie können Arbeits- und Privatleben in Einklang gebracht werden? Welche Folgen hat es, wenn das Verhältnis zwischen beiden nicht ausgeglichen ist? Das Problem gab es schon lange, bevor die „Work-Life-Balance“ Forschungsthema verschiedener Disziplinen wurde. Dr. Eva Ochs vom Institut für Geschichte und Biographie der FernUniversität in Hagen befasste sich in ihrem Habilitationsprojekt „Beruf als Berufung? Die Work-Life-Balance bürgerlicher Männer im 19. Jahrhundert“ mit historischen Entwicklungen, die zu Spannungen zwischen Beruf und Privatleben führten. Und wie gingen Männer damit um, dass ein neues Berufsethos und ein geändertes Familienideal an ihnen zerrten?
„Aufstrebendes Bürgertum“ verändert Familienverhältnisse
Verändert hatte sich das Verhältnis innerhalb von Familien, die dem aufstrebenden Bürgertum – also vor allem Unternehmer, höhere Beamte und freiberuflich Tätige –angehörten, bereits seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts: „Die patriarchalische Grundordnung mit dem ‚Hausvater‘, der der Familie vorsteht und über alle im Haus bestimmt, blieb zwar bestehen“, erläutert Eva Ochs. „Nun erfolgte aber eine Emotionalisierung, die den familiären Binnenraum gegen das Hausvater-Modell abgrenzte.“
Der bürgerliche Ehemann und Vater sollte einerseits eine führende Rolle als fürsorgliches Familienoberhaupt übernehmen, er durfte in der Familie auch Gefühle zeigen. Andererseits musste er in der grauen Berufswelt draußen beim „harten Kampf ums Überleben“ seinen Mann stehen – mit „männlichen Eigenschaften“ wie Mut, Tatkraft, Vernunft oder Energie: „Das führte zu inneren Spannungen.“
Den „bürgerlichen Frauen“ wurden ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ein anderer „Geschlechtscharakter“ zugeschrieben: der weibliche. Die führende Rolle der Männer wurde nun mit biologischen Argumenten begründet, die sich aus der physischen Konstitution der Frau, dem angeblich „schwachen Geschlecht“, ergeben sollten. Daraus wurden wiederum psychische Eigenschaften abgeleitet: Hingebung, Fürsorge, Zuneigung, Duldungsfähigkeit. Danach seien Frauen dafür zuständig, den Nachwuchs aufzuziehen – zuhause und in Berufen der Pflege und Fürsorge.
„Natürlich gab es diese ‚Eigenschaften‘ auch schon früher, jetzt bemühte man sich erstmals um eine Systematisierung“, stellt Ochs fest. „Die geschlechtsspezifischen Zuschreibungen spielten im Bürgertum eine ganz große Rolle. Das ‚Erbe‘ spürt man heute noch bis hin zu der Frage, wer Führungspositionen innehat.“
Leistungsethos und Ausbildung
Damit unterschied sich das bürgerliche Selbstbild erheblich von dem des standesmäßig konkurrierenden Adels, das nicht auf emotionaler Nähe und Gefühl beruhte, sondern auf „funktionellem Zusammenkommen“: Die adligen Ehepartner erfüllten vorgegebene Funktionen, besonders im repräsentativen Bereich. Seine gesellschaftliche und politische Stellung leitete der Adel aus seiner Geburt ab.
Das Bürgertum definierte sich dagegen durch Besitz bzw. Bildung. Daraus entwickelte es ein besonderes berufliches Leistungsethos, aus dem es Herrschaftsansprüche ableitete. „Dieses fast sakrale Arbeits- und Leistungsethos fand sich sogar auf Grabsteinen wieder mit Inschriften wie ‚Rastlose Tätigkeit‘, ‚Nimmermüdes Tun‘ – das war als Norm gesetzt“, so Ochs.
Dieses Ethos lastete besonders auf den Männern, die gleichzeitig fürsorgliche Väter und Ehemänner sein und einen Platz in der bürgerlichen Geselligkeitskultur einnehmen sollten: „Das führte zu inneren Spannungen.“
Hoher Stellenwert der Bildung
Natürlich hat es auch vorher emotionale Wärme in der Familie gegeben, jedoch wurde sie jetzt erstmals bewusst wahrgenommen und thematisiert: „Der Nachwuchs musste ja erst einmal viel Aufmerksamkeit und Zuneigung erhalten, um die ganzen Leistungskriterien und Bildungswerte in ihn zu ‚verpflanzen‘.“ Denn er konnte nicht mehr – wie etwa in einem Handwerksbetrieb – den Vater nachahmen: „Der bürgerliche Vater arbeitete aushäusig, hatte vielleicht sogar studiert. Solche Wurzeln mussten für den Nachwuchs erst noch gelegt werden.“
Dafür wurde die bürgerliche Familie zum „Nest“ mit einer emotionalen Binnenstruktur, in dem das Leistungsethos dem Nachwuchs vermittelt wurde.
Zur Vorbereitung auf eine bürgerliche Karriere gehörte eine gute Ausbildung, die nicht nur Fachwissen vermittelte, sondern auch bestimmte Werte. Sie diente so auch der Herausbildung von Persönlichkeit. Daher hatte Bildung einen hohen Stellenwert. Ziele waren rationale Lebensführung mit vorausschauender Planung, Bedenken notwendiger Schritte und „Ansparen für die Zukunft“, aber auch die Emotionalisierung und Intimisierung des Familienlebens.
„Weiße“ und „schwarze“ Schafe
Trotz der Fokussierung auf die Unternehmensnachfolge erweiterten viele Söhne von Gründern – die sich dem Aufbau des Unternehmens widmeten – ihre Perspektiven. Durch die bessere Ausbildung und ihre guten finanziellen Lebensumstände konnten sie durch die Beschäftigung mit Kultur und mit Kulturreisen ihren Horizont erweitern.
Andererseits konnten oder wollten viele Bürgersöhne den elterlichen Anforderungen nicht genügen. Oft waren dies Zweitgeborene. Die Familien versuchten häufig, sie mit Geld oder Strafen doch noch auf den rechten Weg ins väterliche Unternehmen zu bringen oder das Scheitern zu vertuschen. Viele „schwarzen Schafe“ sollten im Ausland bei befreundeten Kaufleuten hartes Arbeiten lernen, z.T. in Übersee. Zum Teil mit Erfolg. Es gab aber auch Männer, die in der Fremde verarmten, alkoholsüchtig wurden und starben.
Aufstieg aus eigener Kraft
Interessant im Zusammenhang mit ihrem Selbstverständnis ist, wie erfolgreiche bürgerliche Männer ihren Weg bis nach oben deuteten: als ihren eigenen Erfolg. „Alle definieren sich darüber, ihren Aufstieg aus eigener Kraft erreicht zu haben, egal, wie gut ihre finanziellen, sozialen oder kulturellen Startbedingungen waren. Auch die, die aus Unternehmerfamilien stammten wie die Söhne von Werner von Siemens“, so Ochs. „Dieses Narrativ war für die bürgerlichen Männer ungeheuer wichtig.“
Das galt auch für die aus bildungsbürgerlichen Familien Stammenden wie z.B. Rudolph von Delbrück, ein enger Mitarbeiter Bismarcks. Ochs: „Die bildungsbürgerlichen Männer charakterisierten ihr Studium, das sie zu erfolgreichen Anwälten, Ärzten oder Beamten gemacht hatte, als etwas, was auch ihre Persönlichkeit gebildet hatte. Durch die Auseinandersetzung mit zentralen bürgerlichen Werten war es mehr als ein ‚Brotstudium‘.“
Spagat zwischen Beruf und Familien
Viele bürgerliche Männer hatte jedoch das Empfinden, bei dem schwierigen Spagat zwischen Berufsethos und Familienleben keine wirkliche Balance zu finden. So beklagte etwa der Soziologe und Nationalökonom Max Weber seine eingeengte Rolle und beneidete die Frauen um „ihr natürliches Gleichgewicht“ im Leben. Theodor Fontane lag wie viele mit seiner Frau im Dauerstreit darüber, welche Zeit er für die Familie hätte – dabei konnte er als Schriftsteller zuhause arbeiten.
Andere meinten, dass ein beruflich erfolgreicher Mann kein „Pantoffelheld“ sein könne. Wieder andere bestanden darauf, dass der Bereich des Gefühls und der familiären Beziehungspflege eine Domäne der Frau bleiben müsse. Der Unternehmer Werner von Siemens, der sich durch Hauslehrer und Mentoren bei seinen Kindern in der Vaterrolle vertreten ließ, fand es gut, dass Frauen den Männern den Rücken freihielten: „So ist das eben, die Frauen sind zuhause und für das Gefühl und das Soziale zuständig.“
Neben dem Bedauern, wenig Zeit für die Familie zu haben, fand Ochs sogar Äußerungen, wonach der Beruf eine Entlastung sein könne. Etwa, wenn zuhause alle krank waren und der Mann sich in den Beruf oder in die Politik zurückziehen konnte.
Habilitation
In ihrem Habilitationsprojekt „Beruf als Berufung? Die Work-Life-Balance bürgerlicher Männer im 19. Jahrhundert“ untersuchte Dr. Eva Ochs das berufliche Selbstverständnis und die Lebenspraxis von Bürgern des 19. Jahrhunderts. Lebenserinnerungen, Briefe und Tagebücher gaben Einblicke in retrospektive und zeitgenössische Deutungen der individuellen Lebenspraxis und ließen die Erforschung von Selbstbildern zu. Der Schwerpunkt lag auf dem Verhältnis zwischen Arbeit und Familie. Die Historikerin „begleitete“ bürgerliche Männer durch ihre Karriere und fragte, welchen Stellwert die Familie dabei hatte: Wie sahen sich die Bürger selbst in ihrem Bemühen, eine Balance zu finden zwischen Karriere und Familienleben? Verstanden sie sich als „Arbeitssoldaten“, die ihr Leben ausschließlich der beruflichen Sphäre widmeten? Welche Bedingungen stellten sich z.B. bei wohlhabenden (Unternehmer-)Familien für die Ausbildung und Begleitung des Nachwuchses in den Beruf im Vergleich mit Handwerkerfamilien?
Veröffentlichung
Eva Ochs: „Beruf als Berufung? Die Work-Life-Balance bürgerlicher Männer im 19. Jahrhundert“ (SOFIE. Schriftenreihe zur Geschlechterforschung, Band 25), Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, Juli 2020